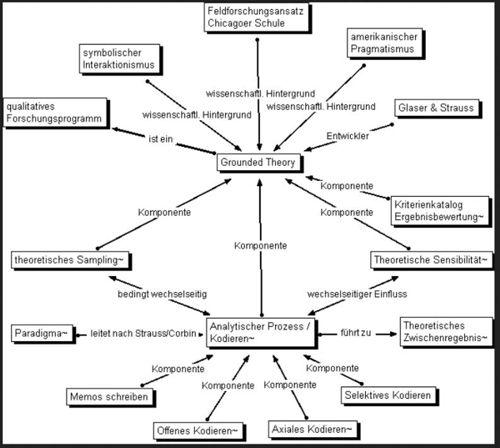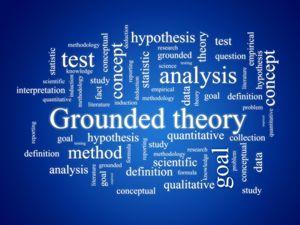Zentrale Veröffentlichung
Glaser, Barney & Strauss, Anselm (2008). Grounded Theory: Strategien qualitativer Forschung (Nachdruck der 2., korr. Auflage). Bern: Huber (Orig. 1967).
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996). Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz.
Übersichtsdarstellungen
Mey, Günter & Mruck, Katja (2009). Methodologie und Methodik der Grounded Theory. In Wilhelm Kempf & Marcus Kiefer (Hrsg.), Forschungsmethoden der Psychologie. Zwischen naturwissenschaftlichem Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik. Band 3 (S. 100–152). Berlin: Regener.
Vertiefende Literatur
Breuer, Franz; Muckel, Petra & Dieris, Barbara (2018). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis (4. Auflage). Wiesbaden: Springer VS, Homepage zum Buch: https://reflexivegroundedtheory.wordpress.com/.
Bryant, Antony & Charmaz, Kathy (Hrsg.) (2010). The Sage Handbook of Grounded Theory. London u. a.: SAGE.
Equit, Claudia & Hohage, Christoph (Hrsg.) (2016). Handbuch Grounded Theory. Von der Methodologie zur Forschungspraxis. Weinheim: Beltz Verlag.
Mey, Günter & Mruck, Katja (Hrsg.) (2011). Grounded Theory Reader (2., überarb. u. erweiterte Auflage). Wiesbaden: VS.
Beispiele
Dieris, Barbara (2006). „Och Mutter, was ist aus dir geworden?!“ Eine Grounded-Theory-Studie über die Neupositionierung in der Beziehung zwischen alternden Eltern und ihren erwachsenen, sich kümmernden Kindern [52 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7 (3), Art. 25. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/144.
Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1965). Awareness of Dying. Chicago: Aldine.
Muckel, Petra (1997). Der Alltag mit Akten – Psychologische Rekonstruktionen bürokratischer Phänomene. Eine empirische Untersuchung in verschiedenen Institutionen auf der Grundlage der Grounded Theory. Aachen: Shaker, https://reflexivegroundedtheory.wordpress.com/empirische-arbeiten/.
Ausgewählte Bachelorarbeiten im Fach Psychologie: https://reflexivegroundedtheory.wordpress.com/bachelor-arbeiten-im-fach-psychologie/
Ausgewählte Diplom- und Masterarbeiten im Fach Psychologie: https://reflexivegroundedtheory.wordpress.com/diplom-und-master-arbeiten-im-fach-psychologie/
[1] Glaser, Barney & Strauss, Anselm (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine
[2] Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1965). Awareness of Dying. Chicago: Aldine.
[3] Glaser, Barney G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.
[4] Strauss, Anselm L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
[5] Charmaz, Kathy (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London u.a.: Sage.
[6] Clarke, Adele (2005). Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. London u. a.: SAGE.
[7] Ruppel, Paul S. & Mey, Günter (2017). Grounded Theory Methodology. In Roxanne Parrott (Hrsg.), The Oxford Encyclopedia of Health and Risk Message Design and Processing (Oxford Research Encyclopedia of Communication). New York: Oxford University Press. DOI: https://oxfordre.com/communication/display/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-522;jsessionid=EE0A881BFADF89BDAEE12B3D6ECE9A0C.
[8] Mey, Günter & Mruck, Katja (2010). Grounded-Theory-Methodologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 614–626). Wiesbaden: VS.
[9] Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet (1996). Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz.
[10] Mühlmeyer-Mentzel, Agnes & Schürmann, Ingeborg (2011). Softwareintegrierte Lehre der Grounded-Theory-Methodologie [156 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(3), Art. 17, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1654.
[11] Mey, Günter & Dietrich, Marc (2016). Vom Text zum Bild – Überlegungen zu einer visuellen Grounded-Theory-Methodologie. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 17(2), Art. 2, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2535.
[12] Dietrich, Marc & Mey, Günter (2018). Grounding visuals. Annotationen zur Analyse audiovisueller Daten mit der Grounded-Theory-Methodologie. In Christine Moritz & Michael Corsten (Hrsg.), Handbuch Qualitative Videoanalyse (S. 135–152) Wiesbaden: Springer VS.